Der Ökonom Thomas Mayer blickt auf die wirtschaftlichen Aussichten des Jahres 2025, gibt Ratschläge, wie man das eigene Ersparte möglichst sturmfest macht, und zieht Parallelen zwischen der Europäischen Union und dem späten Weströmischen Reich.

 IMAGO - Collage: TE
IMAGO - Collage: TE
Tichys Einblick: Herr Professor Mayer, bevor wir auf die Welt im Jahr 2025 schauen, lassen Sie uns kurz zurückblicken: 2000 beschlossen die EU-Staaten in Lissabon, die EU zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Seitdem hat die EU an wirtschaftlichem Gewicht verloren. Was ist aus Ihrer Sicht schief gelaufen?
Thomas Mayer: Zu beschließen: „Wir wollen der wettbewerbsfähigste Wirtschaftsraum werden“, ist eine reine Luftnummer. Zu sagen: Wir, die EU-Bürokratie, entscheiden, zur dynamischsten Region der Welt zu werden, ist pure Anmaßung. Das erinnert an die Planvorgaben aus der Sowjetunion. Da hat man sich auch der Illusion hingegeben, man könnte durch zentrale Planung zur größten Wirtschaftsmacht der Welt aufsteigen und die USA überholen …
… idealerweise „überholen, ohne einzuholen“.
Das galt dann etwas später, wenn ich mich recht erinnere, in der DDR unter Walter Ulbricht. Als man gemerkt hatte, es klappt mit dem Einholen nicht, ließ man das weg und das „Überholen“ stehen, auch wenn es keinen Sinn ergab. Das ganze Projekt war einfach eine grandiose Anmaßung und von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Obwohl die EU gegenüber den USA, aber auch China wirtschaftlich zurückfällt, scheint das Motto in Brüssel – und in Berlin – zu lauten: Jetzt erst recht! Ob nun CO2-Vorgaben für Autoflotten, Lieferkettengesetz oder Auflagen für Kaffeeexporteure, Brüssel verschärft mit deutscher Unterstützung sogar den Lenkungskurs. Die Begründung: Andere lenken ja auch. Etwa die USA mit ihrer Industrieansiedlungspolitik, China mit Industriesubventionen. Das stimmt ja, nur: In den USA und China entwickelt sich die Wirtschaft deutlich besser als hier. Warum funktioniert dort die interventionistische Politik besser als hier?
Beginnen wir mal mit China, da ist es einfacher zu erklären. Sie können mit einer sehr arbeitsamen, bildungsaffinen und gefügigen Bevölkerung einiges erreichen. Das Streben nach Bildung hat eine lange Tradition in China. Das Erfolgsrezept Chinas war, den Westen, den Kapitalismus zu imitieren. Dieser Strategie zu folgen war nach der desaströsen Herrschaft Mao Tse-tungs die große Leistung von Deng Xiaoping. Man kann mit einer Bevölkerung wie der Chinas also vieles erreichen, wenn man in der Wirtschaftskraft aufholen möchte. Nun ist man der Spitze näher und weiß nicht recht, wie es weitergehen soll.
Und die USA?
In den USA hat sich unter Joe Biden die Industriepolitik prächtig entwickelt. Aber ob sie so erfolgreich sein wird, wie viele bei uns glauben, wage ich zu bezweifeln. Bisher sehen wir nur, dass viel Geld für die Ansiedlung von Unternehmen ausgegeben wurde. Aber was daraus wird, bleibt abzuwarten. Ich habe große Zweifel, dass das tatsächlich zum langfristigen Potenzialwachstum der US-Wirtschaft beiträgt. Es war ja nicht der öffentliche oder öffentlich subventionierte Sektor, in dem die Grundlagen für den wirtschaftlichen Erfolg der USA gelegt wurden. Es war der private Sektor. Die Internettechnologie wurde zwar vom US-Verteidigungsministerium in den 1960er-Jahren angestoßen, dann aber von Unternehmern und Wissenschaftlern zu dem entwickelt, was wir heute sehen.
Was erwarten Sie auf wirtschaftlichem Gebiet von der Regierung Trump?
Donald Trump wird in Deutschland sehr kritisch gesehen. Natürlich ist er ein unberechenbarer Charakter, sodass wir mit unangenehmen Überraschungen rechnen müssen. Aber für die Wirtschaft hat er einen Instinkt. Er ist in die Nähe der Technolibertären gerückt und könnte diesen und anderen Unternehmern größere Freiheiten lassen. So hat er zum Beispiel in der „Securities and Exchange Commission“, der Finanzaufsichtsbehörde, die Bremser gegen neue Entwicklungen, insbesondere im Bereich der Kryptowährungen, durch Personen ersetzt, die für Neues offener sind. Es ist ein Irrtum, zu meinen, die USA wären durch Industriepolitik groß geworden. Im Gegenteil – die USA sind dadurch groß geworden, dass man den Unternehmern Freiraum gegeben hat. Als ich von 1983 bis 1990 in den USA gelebt habe, habe ich hautnah miterlebt, wie die Reagan-Administration die Wirtschaft dereguliert hat. Dadurch wurden viele Beschränkungen aufgehoben, die zuvor den Wettbewerb in der Telekommunikationsbranche behindert hatten. Dies ermöglichte neuen Unternehmen den Markteintritt und förderte Innovationen. Die Informationstechnologie wurde sehr, sehr unternehmerisch vorangetrieben. Dafür stehen Namen wie Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Jobs und heute besonders Elon Musk. Unter der neuen Trump-Regierung könnten die USA durch eine neue Welle der Deregulierung an diese Erfolgsgeschichte anknüpfen.
Blicken wir jetzt nach Deutschland: Hier macht die Entwicklung wenig Hoffnung. Nicht nur nach Ihren Zahlen liegt die Wirtschaftsentwicklung in den USA deutlich über dem Trendpfad der vergangenen Jahre, die EU liegt ohne Dynamik im Trendpfad – und Deutschlands Wirtschaft knickt mittlerweile dramatisch nach unten ab. Das Land erlebt vor allem eine Industrieproduktionskrise. Wo liegen die tieferen Ursachen? Und lässt sich dieser Abstieg noch bremsen?
Um es griffig zu formulieren: Das deutsche Geschäftsmodell, das deutsche Erfolgsrezept bestand darin, dass man den Fleiß einer gut ausgebildeten Erwerbsbevölkerung verbunden hat mit dem Know-how, der Fähigkeit zur Tüftelei der Unternehmer. Hinzu kam billige Energie. Das war lange das Erfolgsrezept zum Aufstieg des Industrielandes Deutschland. Ende des 19. Jahrhunderts war Kohle die günstige Energiequelle, dann kam das Erdöl und schließlich die Atomkraft, die für noch günstigere Energie hätte sorgen sollen. Alle drei Säulen – billige Energie, Bildung und Fleiß der Beschäftigten, Freiheit der Unternehmer – wanken schwer oder sind schon umgefallen. Wenn man nach den Gründen dafür sucht, wird man in der Politik der verschiedenen Regierungen von Angela Merkel fündig. Aus der Kernkraft auszusteigen, die Kohlekraftwerke abzuschalten und zum Ausgleich der Versorgungsschwankungen der weniger verlässlichen erneuerbaren Energiequellen auf russisches Gas zu setzen, ging bekanntlich gründlich schief. Diese Politik ist grandios gescheitert. Das, was das „Wall Street Journal“ schon vor Jahren als „die dümmste Energiepolitik der Welt“ bezeichnete, liegt jetzt in Trümmern. Die Säule der billigen Energie ist weg.
Schauen wir uns die anderen an, zunächst Fleiß und Bildung der Beschäftigten: Wir haben die niedrigste jährliche Arbeitszeit und einen der höchsten Krankenstände unter den Industrieländern; unsere Schulen bringen immer weniger Schüler hervor, die wenigstens die Grundfertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen beherrschen. Arbeit, Fleiß und Bildung erodieren in erschreckendem Ausmaß. Und wie steht es um den Unternehmergeist? Wir hatten in der Gründerzeit auch einmal so „verrückte“ Unternehmer wie die Amerikaner in der Gegenwart: Etwa Gottlieb Daimler, der „das Beste oder nichts“ wollte. Carl Benz, Werner von Siemens, Robert Bosch. Wo sind ihre Nachfahren? Unsere Gates, Jobs, Bezos oder Musks? Die gibt es nicht. Bei uns wird die Wirtschaft durch staatliche Regulierung eingehegt und die Großunternehmen von regierungshörigen Managern geleitet. Die nationale Bürokratie ist unheilvoll mit der EU-Bürokratie zu einem undurchdringlichen Gestrüpp verwoben und macht die mittelständische Wirtschaft fertig. Die Eurokraten haben in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament, dem die volle demokratische Legitimation fehlt, eine unglaubliche Bürokratenherrschaft aufgebaut. Das Knäuel von EU-Recht und nationalem Recht ist kaum noch zu entwirren.
Jetzt kommt es zwischen dieser Europäischen Union mit dem schwachen Deutschland im Zentrum und Trumps USA zum Zollstreit oder Zollkrieg. Was vor allem bedeuten wird: deutlich höhere Zölle für EU-Waren, die in die USA gehen. Wie wirkt sich das wirtschaftlich aus?
Prinzipiell sind Zölle schlecht für die Weltwirtschaft. Wir haben durch Handelsliberalisierung und Globalisierung einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Insofern ist Trumps Vorliebe für Zölle aus ökonomischer Sicht schlecht. Politökonomisch kann man aber die Drohung mit Zöllen zur Öffnung anderer Märkte verstehen. Das gilt auch gegenüber uns. Denn es ist ja nicht so, dass die Europäische Union ein völliger Freihändler wäre. Wir tun zwar so, als ob wir ein leuchtendes Beispiel für den Freihandel wären. Aber ich erinnere nur an unseren Agrarmarkt, den wir sehr bürokratisch gegenüber dem Ausland abschotten.
Auch die EU-Strafzölle für Elektroautos aus China sprechen für eine immer stärkere Abschottungstendenz.
Ja, der Protektionismus steigt auch in Europa. Dabei liegen die Strafzölle für chinesische Autos im Graubereich. Nach den Regeln der Welthandelsorganisation kann man Abwehrzölle gegen Importe von staatlich subventionierten Gütern verhängen. Aber auch wir subventionieren unsere Industrie. Nach Berechnungen des Flossbach von Storch Research Institute haben die deutschen DAX-Konzerne über die vergangenen acht Jahre 44 Milliarden Euro an Staatshilfen erhalten. Also könnten andere auch Strafzölle gegen deutsche Autos erheben. Außerdem regulieren wir Produkte angeblich aus Gründen des Schutzes der Konsumenten oder der Umwelt. Andere könnten das aber als nicht-tarifäre Handelshemmnisse sehen. Manche werden sich noch an die unsägliche Debatte über amerikanische Chlorhühnchen erinnern. Dies war nur die Spitze eines Eisbergs von ähnlichen Bedenken, an denen das Freihandelsabkommen TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership – mit den USA gescheitert ist. Heute verlangen wir gewaltige Strafzahlungen von amerikanischen Technologieunternehmen wie Apple oder Google wegen Behinderung des Wettbewerbs. Trump könnte jedoch auch das als eine Art Zoll sehen.
Wenn sich jetzt die Zollauseinandersetzung zwischen der EU und den USA unter Trump wesentlich verschärft, kommt es dann nicht vor allem darauf an, wer aus der stärkeren und wer aus der schwächeren Position aus operiert?
Ja natürlich. Und die stärkere Position liegt ganz klar bei den USA. Im Finanzbereich wird sehr viel über den amerikanischen Exzeptionalismus debattiert. Natürlich besteht die Gefahr, dass am amerikanischen Aktienmarkt eine Blase entstanden ist. Aber auch die amerikanische Realwirtschaft ist „exzeptionell“. Seit zwei Jahren schüttelt sie alle Rezessionsprognosen ab, während die deutsche Wirtschaft seit fünf Jahren nicht mehr gewachsen ist und die Eurozone nur im Kriechgang vorankommt. In den USA wächst die Produktivität, während sie bei uns zurückgeht. Die Wirtschaft in den USA läuft zumindest bisher wie geschmiert, könnte man sagen. Deshalb befindet sich das Land klar in der stärkeren Position.
Was heißt das für uns?
Das heißt, wir sollten uns jetzt anstrengen, dass wir für die Trump-Administration ein interessanter Partner werden. Angesichts der Malaise, in der ganz Europa gerade steckt, sind wir gegenwärtig jedoch eher eine Belastung als ein starker Partner.
Der finanzielle Exzeptionalismus der USA beruht auch auf der Sonderstellung des Dollar als Reservewährung Nummer 1. Nun sehen wir ja einen Wettbewerb der Zinssenkungen zwischen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (EZB), wobei die EZB bereits durchblicken lässt, die Zinsen noch weiter senken zu wollen. Was zu der Frage führt: Könnte es ab einem bestimmten Punkt schwierig werden, noch Investoren für Eurostaatsschuldpapiere zu finden? Mit anderen Worten: Was wird aus dem Euro?
Das hängt ganz wesentlich davon ab, was in Deutschland nach den kommenden Wahlen passiert. Denn bisher ist Deutschland der fiskalische Anker des Euro. Hätte Deutschland sich nicht an die Schuldenbremse gehalten, wäre die Gesamtverschuldung der Eurozone wahrscheinlich so hoch wie oder vielleicht sogar noch höher als die der USA. Wir könnten in Deutschland ja locker unsere Staatsschuldenquote verdoppeln, um mit Italien oder Frankreich gleichzuziehen.
Dann säße Deutschland in der gleichen Falle wie Frankreich, das an seinen Schulden zu ersticken droht.
Dann wären wir tatsächlich in der Liga von Frankreich und Italien. Warum auch nicht?, denken manche. Doch der Finanzmarkt würde die Eurozone dann völlig anders behandeln. Vielleicht wie ein großes Italien.
Die Entscheidung über den Euro fällt also in Deutschland?
Ja. Nehmen wir mal an, dass die CDU/ CSU mit einem der Rest-Ampel-Partner koaliert. Dann würde wohl das herauskommen, was Christian Lindner „Ampel light“ nennt. Die Schuldenbremse würde geschleift, überall würden die Staatsfinanzen aus dem Ruder laufen, Die Inflation würde wieder steigen und das Wirtschaftswachstum versiegen. Was dann mit dem Euro passieren würde, kann man gerade in Brasilien beobachten, wo die Landeswährung Real abstürzt.
Das heißt: Endet in Deutschland die relative Zurückhaltung bei der Verschuldung, dann würden die Märkte einen ganz anderen Risikozuschlag verlangen, um überhaupt noch Geld für Euroanleihen zur Verfügung zu stellen?
Absolut. Bisher hält Deutschland den Euro noch einigermaßen stabil. Nicht von ungefähr sind Bundesanleihen das Safe Asset im Euroraum.
Bei all diesen Unsicherheiten, über die wir hier sprechen: Was kann ein Kleinanleger tun, um sein Erspartes möglichst sturmfest zu machen? Denn stürmisch werden die Zeiten ja wohl auf jeden Fall.
Beginnen wir mit den Zinsprodukten: Reine Zinsanlagen werden sich wieder weniger rechnen. Die EZB will die Zinsen weiter senken, obwohl man darüber trefflich streiten kann, ob die Inflation wirklich besiegt ist. Meiner Meinung nach ist sie das nicht. Wir befinden uns momentan eher in einem Inflationstal, dem ein erneuter Berg folgen könnte.
Bis auf welche Höhe müssen wir uns da einstellen?
Vermutlich nicht so hoch wie während der Pandemie, aber deutlich höher als davor. Die Europäische Zentralbank wird das hinnehmen – hinnehmen müssen. Denn sie kann nicht wie die US-Notenbank die Inflation wirklich mit beiden Händen bekämpfen. Eine Hand ist ihr auf dem Rücken festgebunden. Denn sie muss auf die hoch verschuldeten Staaten der Eurozone Rücksicht nehmen. Heute liegen die Probleme nicht mehr in der Peripherie wie in der letzten Eurokrise, also in Griechenland oder in Portugal. Jetzt erodiert der Kern. Und wenn die Deutschen im Februar eine Ampel-light-Regierung wählen, dann folgt der Erosion der Durchbruch. Die EZB muss den Staat finanzieren, auch den deutschen, wenn die Neuverschuldung ungebremst steigt. Wie von der „fiskalischen Theorie des Preisniveaus“ beschrieben, treibt dann die Fiskalpolitik die Inflation. Der Realzins wird null oder negativ werden, und Zinsanlagen lohnen sich nicht mehr.
Halten wir also fest: Anleihen sind nicht so gut, wenn man sein Vermögen erhalten will. Zu viel Bargeld auf dem Konto erst recht nicht. Was kann der Anleger also tun?
Aktien bieten einen gewissen Schutz vor Inflation, wenn die Unternehmen reale, also inflationsbereinigte Gewinnsteigerungen erzielen. Wenn man sich auf der Welt umschaut, wo dies sein könnte, dann bleiben die USA das attraktivste Land. Anleger müssen ja nicht gleich den S & P-500-Index kaufen. Der kapitalgewichtete amerikanische Aktienindex ist momentan stark auf einige wenige Titel konzentriert. Aber in ihrem Aktienportfolio sollten US-Titel eine gewichtige Rolle spielen. Das tun sie auch in einem breiteren Index wie zum Beispiel dem MSCI World. Außerdem sind dort auch interessante europäische Firmen wie zum Beispiel Novo Nordisk in Dänemark enthalten.
Der Goldpreis steht schon ziemlich hoch. Lohnt sich der Einstieg trotzdem?
Langfristig sehr wahrscheinlich. Denn Gold ist eine der ältesten Währungen und würde auch den US- Dollar überleben, wenn dieser von der hohen Staatsverschuldung der USA irgendwann einmal ausgezehrt würde.
Es gibt ja schon Prognosen von bis zu 4800 Dollar pro Unze in den nächsten Jahren. Halten Sie das für realistisch? Das würde ja bedeuten, dass sich der 2024 enorm gestiegene Goldpreis nochmals fast verdoppelt.
Ich habe in meiner jahrzehntelangen Tätigkeit gelernt, dass Punktprognosen Glückssache sind. Aber ich würde sagen, dass insbesondere vor dem Hintergrund der Risiken für die staatlichen Fiat-Kreditgeld-Währungen alles dafür spricht, auf Alternativen zu den Staatswährungen zu setzen. Denn die Aussichten für alle Staatswährungen sind eher mau. Wir haben über den Euro schon gesprochen. Wie die EZB schon jetzt kann in Zukunft auch die US-Federal-Reserve unter den Einfluss des Staates geraten und für dessen Finanzierung sorgen müssen. Noch immer profitieren die USA vom sogenannten „exorbitanten Privileg“ des Emittenten der Weltreservewährung. Aber durch die fiskalpolitische Dominanz der Geldpolitik kann dieses Privileg verloren gehen. Dagegen ist Gold eine gute Absicherung.
Zehn Prozent Gold im Portfolio – ist das eine vernünftige Größenordnung?
Ja. Aber es kommt auch auf die eigene Fähigkeit an, Preisschwankungen zu ertragen, die bei Gold schon mal hoch sein können. Und was Anleihen angeht, da sollte man meines Erachtens eher in kürzeren Laufzeiten anlegen. Denn wie wir 2022 gesehen haben, kann der Preis längerer Laufzeiten regelrecht einbrechen, wenn die Inflation über Erwarten steigt.
Da wir gerade darüber gesprochen haben, wie Staatswährungen unter die fiskalische Fuchtel des Staates geraten: Als Alternative bieten sich neben Gold in jüngerer Zeit ja auch Kryptowährungen an, die allerdings 2024 schon sehr stark nach oben geklettert sind. Was meinen Sie: einsteigen oder nicht?
Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich die Kryptowährungen besser verstehen kann, und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass man diese Währungen gut begreifen kann, wenn man sie wie Sprachen versteht. Es gibt Hochsprachen, und es gibt Dialekte. Die Kryptos ähneln Dialekten oder besser Slangs, gewissermaßen Jugendslangs. Lange hieß es, Bitcoin ist eine pure Blase, denn es hat ja keinen Gegenwert. Aber wenn ich mit der Bitcoin-Community spreche, ist mein Eindruck: Da gibt es schon eine Menge Leute auf der Welt, die diesen Slang sprechen. Und es werden immer mehr, sodass der Slang kaum aussterben dürfte.
Um in Ihrem Bild zu bleiben: Manche Slangbegriffe können ja auch irgend wann einmal Eingang in die Hochsprache finden.
So ist es. Und es kann sogar sein, dass sich schließlich der Slang insgesamt zur Hochsprache entwickelt.
Was folgt nun für einen Anleger daraus?
Ob die Kryptos zur Hochsprache werden, also zur anerkannten Währung, das weiß ich nicht. Man kann darauf spekulieren, aber wenn man das tut, muss man damit rechnen, dass die Spekulation nicht aufgeht und das eingesetzte Geld verloren ist. Solche Verluste muss man verkraften können. Daher würde ich Bitcoin oder andere Kryptowährungen wie ein Lotterielos sehen, das man einem Portfolio beimischen kann. Im Verlauf des letzten Jahres hat dieses Los einen ordentlichen Gewinn abgeworfen.
Egal ob aus der Sicht eines Anlegers oder einfach nur als Bürger, wichtig ist immer, mit welchem Grundgefühl man auf das kommende Jahr schaut. Und vieles spricht dafür, dass 2025 für die Deutschen wirtschaftlich schlechter wird als 2024. Oder?
Das Schicksal Deutschlands und damit das Schicksal Europas hängt von der kommenden Wahl in Deutschland ab. Sie bietet die letzte Gelegenheit, eine Regierung aufzustellen, die zu den umfassenden Reformen fähig ist, die Deutschland und Europa jetzt brauchen. Dafür gibt es historische Präzedenzfälle. Denken Sie an das Lambsdorff-Papier von 1982, das zum Bruch der sozialliberalen Koalition führte, oder an die Schröder’sche Agenda 2010 im Jahr 2002. Aber was jetzt nötig ist, wäre noch viel umfassender als die Reformen des Lambsdorff-Papiers oder Schröders Agenda. Wir stecken tiefer in der Klemme als damals, weil sich die Welt um uns herum grundsätzlich verändert hat. Der Nachkriegszeit folgte eine euphorische Zwischenzeit nach dem Fall der Sowjetunion. Es war aber ein Irrtum, zu glauben, dass wir mit dem Untergang des Sowjetimperiums „das Ende der Geschichte“ erreicht hätten. Dieser Irrtum holt uns jetzt ein. In den langen Regierungsjahren von Angela Merkel haben wir die geoökonomische Schönwetterphase nicht genutzt, um uns auf das neue Zeitalter vorzubereiten, das sich Mitte der 2010er-Jahre mit dem Aufstieg Xi Jinpings in China und Putin-Russlands Annexion der Krim abgezeichnet hat. Jetzt müssen wir nicht nur alte Versäumnisse aufholen, sondern uns auch an ein radikal verändertes globales Umfeld anpassen. Das braucht tatsächlich eine enorme Disruption. Wir müssen uns praktisch neu erfinden.
Was ja so ein bisschen gegen die Mentalität von Deutschland spricht. Die Mehrheit in Deutschland möchte keine Disruption, sondern, wenn überhaupt, Veränderungen in kleinen Schrittchen.
Dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Die kommende Wahl ist die letzte Chance. Wenn wir sie verpassen, dann ist Deutschland in vier Jahren noch älter, noch festgefahrener, noch ärmer. Ob eine Bundeskanzlerin Alice Weidel, über die manche heute schon reden, dann das Ruder noch herumwerfen kann, ist mehr als fraglich.
Der Bundespräsident hat den Bundestag aufgelöst. Welches Ergebnis erwarten Sie, welches erhoffen Sie sich von der Bundestagswahl am 23. Februar?
Laut heutigen Umfragen wird es wohl eine Ampel-light-Regierung geben, mit der der Abstieg weitergehen wird. Aber meine Hoffnung ist, dass die Umfragen wie schon so oft danebenliegen und dass die Wählerschaft die Zeichen an der Wand sieht: Sie muss der neuen Regierung einen kraftvollen Reformauftrag geben. Und das kann gegenwärtig wohl nur gehen, wenn die Union mit der FDP eine regierungsfähige Mehrheit erhält. Wenn das nicht geschieht, sehe ich eine düstere Zukunft für Deutschland und Europa voraus. Denn wenn Deutschland jetzt nicht die Wende schafft, wird Frankreich sie bestimmt auch nicht schaffen. Und dass Italien unter den größeren Ländern heute als der politisch und wirtschaftlich stabile Faktor im Euroraum gilt, sagt viel über den Zustand Europas aus.
Italien galt ja noch vor Kurzem als das politische und wirtschaftliche Hochrisikoland schlechthin.
Ich lebe seit Ende 2023 in Italien und habe verfolgt, wie Giorgia Meloni eine stabile Regierung führt, die man „post-woke“ nennen könnte. Die Zeit der „woken Ideologie“ ist vorbei, und Italien ist bei der Verschrottung dieser Ideologie den meisten anderen Ländern Europas – und insbesondere Deutschland – weit voraus. Aber die wirtschaftlichen Probleme Italiens haben sich über Jahrzehnte so tief eingefressen, dass auch eine Regierung Meloni keine wirkliche Wende mehr schaffen kann. Wenn wir aus Deutschland heraus nach Italien blicken, sehen wir unsere Zukunft, wenn wir jetzt keine grundlegenden Veränderungen hinbekommen: eine schleichende wirtschaftliche Verarmung und den Abstieg in die geopolitische Bedeutungslosigkeit.
Das ist ein ziemlich pessimistischer Ausblick für einen Ökonomen.
Je älter ich in meinem Beruf werde, desto mehr sehe ich, dass die ökonomische Wissenschaft mit anderen Wissenschaften ergänzt werden muss. Dazu gehört neben der Psychologie und Soziologie vor allem die Geschichtswissenschaft. Wenn ich mir die Geschichte Europas anschaue, dann sehe ich heute zum Teil beängstigende Parallelen zum Untergang Westroms.
Die neuere Forschung geht davon aus, dass sich der Untergang Westroms wohl sehr viel schneller vollzogen hat, als man lange annahm.
Von Edward Gibbons Meisterwerk kennen wir die innere Aushöhlung der römischen Gesellschaft durch das, was mit „spätrömische Dekadenz“ bezeichnet wird. Neuere Forschungen, die sich nicht nur auf schriftliche Überlieferungen, sondern auch auf archäologische Funde stützen, sehen jedoch einen Kipppunkt. So beschreibt Peter Heather zum Beispiel, wie Westrom von den Veränderungen seiner Umwelt regelrecht eingekesselt wurde. Bis Mitte des 5. Jahrhunderts wähnten sich die Römer noch als Weltmacht, waren aber tatsächlich von einer neuen Wirklichkeit umzingelt. Und sie haben es nicht geschafft, damit fertigzuwerden.










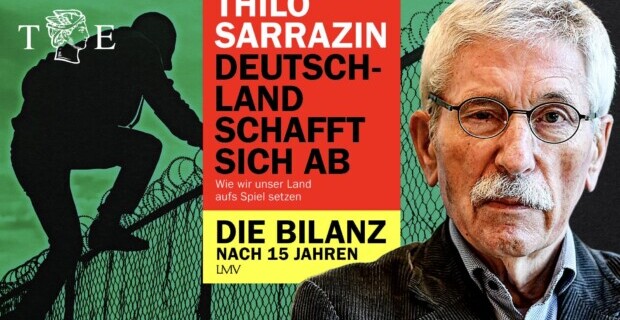




Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Das Ersparte abzusichern ist nahezu unmöglich, es sei denn man bringt es rechtzeit aus dem Land und selbst Gold oder Immobilien sind vor Zugriffen des Staates nicht sicher, ergo bleibt nur noch das Loch in der Erde, wo man nach alter Väter Sitte den Schmuck versteckt, damit ihn andere später finden werden. Somit hat Thoma Mayer in seiner Analyse absolut recht, denn wir haben allenfalls Mangelverwalter an der Spitze, die unfähig sind uns vor den Gefahren des Lebens zu beschützen und hinzu kommt noch ihre fatale Eigenheit, das ganze zusätzlich durch schädliche Maßnahmen zu befeuern und das nennt man Staatszersetzung… Mehr
Mayer mag vielleicht ein wirtschaftswissenschaftliches Schwergewicht sein – wenn er davon träumt, dass CDU und FDP eine „regierungsfähige Mehrheit“ erhalten könnte, dann ist er genau das: Ein Traumtänzer. Sieht er bei der AfD keine wirtschaftspolitische Kompetenz (Weidel ist immerhin pormovierte Wirtschaftswissenschaftlerin) oder traut er sich nicht, das anzusprechen? Und warum fragt Wendt nicht nach?
Ich wiederhole auch an dieser Stelle Gorbatschow:
„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“.
Die Bürger der ehemaligen DDR werden sich noch gut erinnern, wie recht Gorbatschow 1989 hatte und bis heute noch hat.
> Man kann mit einer Bevölkerung wie der Chinas also vieles erreichen, wenn man in der Wirtschaftskraft aufholen möchte. Nun ist man der Spitze näher und weiß nicht recht, wie es weitergehen soll.
In den letzten 2000 Jahren kam mindestens die Hälfte des weltweiten BIP aus China und Indien – bis auf die 200 Jahre ab der industriellen Revolution. Da die Völker Asiens den Westen eingeholt und zum Teil überholt haben, werden die schon weitere Wege finden,
Die Zeit unter Mao war besonders übel – Marxismus war aber ein Import aus Europa, wo es immer noch viele Freaks hat.
Der Professor spricht von Ökonomischer Wissenschaft und will die durch „Psychologie und Soziologie vor allem die Geschichtswissenschaft“ ergänzen.
Ähm, wo ist da irgend eine Wissenschaft? Vielleicht sollte man die Kaffesatzleserei und Glaskugelkunde auch zur Wissenschaft erklären?
Sinnvollerweise sollte man jedoch den gerade verlorenen Krieg und die Russlandsanktionen mit einrechnen wenn man die letzten Jahre ökonomisch betrachtet sowie die Invasion von Millionen Analphabeten nicht ignorieren. Vermutlich auch die an die USA verschenkten Milliarden als Ausgleich für russisches Erdgas gegen vielfach teureres USA Frackinggas?
Hm – da muss ich mein Portfolio wohl auf das Gegenteil der Empfehlungen hier im Artikel umstellen.
Der letzte Satz könnte auch für Brüssel stehen. Wenn man die Reaktion auf die Rede von Vance sieht, besonders in Deutschland, begreift man, daß hier nur der Untergang bevorstehen kann. Genauso starrköpfig hat damals die DDR-Regierung auf Gorbatschow reagiert – und kurze Zeit darauf war die DDR erledigt.
Ich werde weder FDP noch CDU wählen, um meine denkunwilligen Mitbürger zu retten.
Abgesehen von der spätmodernen Dekadenz heute, sprechen wir von „Nullwachstum“ in Nominalen, die Jahr für Jahr der Geldmengenausweitung unterliegen. Wenn ich jedoch einfach 10 % Geldmenge mehr aufschreibe und habe real eben nicht 10 % mehr, was ist dann in Wirklichkeit passiert? Immerhin: Thomas Mayer lernt hinzu, je älter und erfahrener er wird; da sind Flossbach und Storch besser beraten als alle anderen.
Endlich mal ein Ökonom der auch etwas Verstand hat! Er sagt genau dass was eigentlich jeder normal denkende Mensch wissen müsste!
Die nächste Wahl ist die LETZTE Chance… und sie wird aller Voraussicht vergeben werden da nur noch Lowperformer a la Esken und Merz übrig sind…
Ich hätte den Herrn gefragt, ob es einen Zusammenhang zwischen den rasant steigenden Schulden der letzten 3 Jahre in USA und dem „robusten“ GDP Wachstum von ca. 3% gibt? Die USA fahren ein Budgetdefizite wie in Kriegszeiten von 6-7% pro Jahr. Biden hat mit dem gedruckten Geld jede Menge „Governmental jobs“ geschaffen, die die Arbeitslosigkeit relativ niedrig gehalten haben. Meine Frage wäre: Was würde in den USA das Wirtschaftswachstum seit 2022 in GDP ohne diese Verschuldung betragen haben? Antwort: Es würde kein Wachstum gegeben haben sondern die Wirtschaft wäre geschrumpft wie in DE mit seiner Schuldenbremse. Würde Deutschland seine Schuldenbremse… Mehr