Europa verliert im globalen Technologie-Wettlauf weiter an Boden, während die USA mit innovationsfreundlicher Politik Milliardenwerte schaffen. Tech-Investor Florian Leibert fordert radikales Umdenken: Statt Regulierung und Misstrauen braucht es eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Kapital und Technologie.


Ein Bild geht um die Welt: Bei der Amtseinführung von Donald Trump zu seiner zweiten Präsidentschaft sind der US-Präsident, Tech-Größen wie Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und Elon Musk sowie führende Investoren zu sehen. Dieses Bild hat eine hitzige Diskussion ausgelöst – nicht nur über die Personen, sondern über die zunehmende Verschmelzung von Politik, Kapital und Technologie.
Die Risiken dieser Entwicklung werden vielfach beleuchtet. Dennoch sollten wir auch die Chancen diskutieren, die daraus entstehen können. Technologie ist nichts, was überreguliert oder gar ausgebremst werden muss, wie es in Europa oft den Anschein hat. Die Kluft zu den USA wird hierdurch nur verstärkt.
Ein Beispiel dafür ist der AI Act der EU, der strikte Anforderungen an Unternehmen aller Größen stellt – von Risikobewertungen bis hin zu umfassenden Transparenzverpflichtungen. Während die Absicht, den technologischen Fortschritt zu regulieren, lobenswert sein mag, führen diese Regelungen dazu, dass Innovationen behindert und Investoren abgeschreckt werden. Selbst Mario Draghi kritisierte die EU-Regulierungen, die bereits durch die DSGVO kleinen Tech-Unternehmen enorme Kosten aufbürdeten und deren Gewinne um über 15 Prozent reduzierten. Ein prominentes Beispiel ist Meta, das seine leistungsfähigen KI-Modelle wie Llama nicht in Europa auf den Markt bringt – aufgrund der hohen regulatorischen Anforderungen.
Im Gegensatz dazu haben die USA den Übergang von einer Industrienation zu einer Technologienation geschafft wie kein anderes Land. Diese Technologiefreundlichkeit ist ein entscheidender Antrieb für wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstand. In Wachstumssektoren wie Defense, Künstliche Intelligenz und Krypto zeigt sich dieser Ansatz besonders deutlich. Doch gerade in Europa werden diese Branchen oft negativ konnotiert. Hier wäre ein Umdenken erforderlich: Statt Technologie als Bedrohung zu sehen, sollte man sie als Chance begreifen.
Symbiotisches Zusammenwirken
Ein Blick auf das Silicon Valley verdeutlicht, wie eine enge Verbindung von Politik, Kapital und Technologie zu beispiellosem Wachstum führen kann. Silicon Valley, das Epizentrum der US-Technologieindustrie, hat eine ökonomische Kraft, die ihresgleichen sucht. Fünf der „Magnificent Seven“-Aktien – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Nvidia – stammen aus dem Valley. Mit einem Gesamtwert von 14 Billionen Dollar übertrifft das Silicon Valley bei Weitem die gesamte Marktkapitalisierung deutscher börsennotierter Firmen, die bei gut zwei Billionen liegt.
Doch dieser Erfolg ist kein Zufall. Er basiert auf jahrzehntelanger staatlicher Unterstützung für die Technologieentwicklung. Bereits während des Zweiten Weltkriegs flossen massive Investitionen in die Elektronikforschung, was die Grundlage für den technologischen Fortschritt schuf. Die enge Zusammenarbeit zwischen Investoren, Universitäten, militärischen Auftraggebern und Unternehmen ermöglichte es Talenten, Innovationen hervorzubringen.
Europa hingegen leidet unter einem Mangel an Kapital. Start-ups haben oft Schwierigkeiten, die nötigen Mittel für Wachstum und Innovation zu finden. Viele Investitionen in deutsche Tech-Unternehmen kommen nicht aus Europa, sondern aus Nordamerika. US-Pensionsfonds halten heute einen wesentlich größeren Anteil an deutschen Tech-„Unicorns“ als ihre europäischen Pendants.
Eine mögliche Lösung wäre die Öffnung von öffentlichen und privaten Pensionsfonds für Investitionen in Risikokapital, Growth Equity und Private Equity. Dies könnte nicht nur neue Arbeitsplätze schaffen, sondern auch das wirtschaftliche Ökosystem stärken und den Sparern gleichzeitig höhere Renditen bescheren.
Am Ende bleibt festzuhalten: Eine enge Verbindung von Politik, Kapital und Technologie ist essenziell, um Europa im globalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu halten. Technologie ist nicht nur eine Herausforderung, sondern vor allem eine Chance – und es liegt an uns, diese zu nutzen.
FLORIAN LEIBERT ist ein deutscher Technologieunternehmer und Investor mit besonderer Expertise in der Entwicklung von Cloud-Infrastruktur. Er ist Co-Gründer und General Partner des Technologieinvestors 468 Capital.
Seine Karriere startete Florian Leibert als einer der ersten Mitarbeiter bei Twitter und Airbnb, wo er jeweils als Technischer Leiter tätig war. Im Jahr 2013 gründete er gemeinsam mit seinen beiden Co-Gründern das Unternehmen Mesosphere in San Francisco. Mesosphere entwickelte ein Datacenter Operating System (DC/OS) mit namhaften Kunden wie NBC-Universal, Deutsche Telekom und Audi. Unter Leiberts Leitung erhielt Mesosphere mehr als 250 Millionen US-Dollar Kapital von führenden Investoren, darunter Andreessen Horowitz, Microsoft und Khosla Ventures. Im Jahr 2019 zog sich Leibert aus der operativen Leitung von Mesosphere zurück. Seit 2020 ist er Co-Gründer und General Partner von 468 Capital, einem führenden Technologieinvestor mit Sitz in Berlin und San Francisco.
Florian Leibert wurde in Schweinfurt, Deutschland, geboren und ist studierter Informatiker.









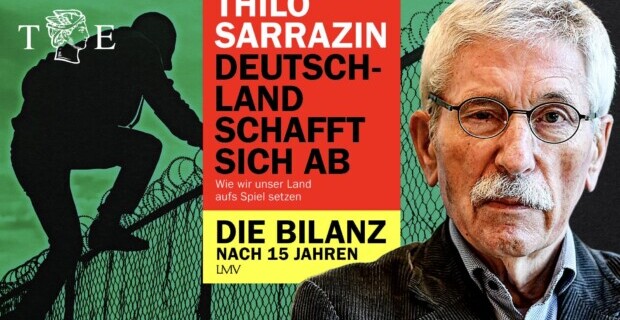




Sie müssenangemeldet sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können
Bitte loggen Sie sich ein
Der gute Mann braucht nur zur Wahl der AFD aufrufen, denn das traut sich aus der Wirtschaft fast niemand. Aber diesen Mumm hat er nicht. Allgemeines Blabla ändert an den politmedialen Zuständen in der Republik nichts.
Selbst der VDA (Verband der Automobilhersteller) oder das Wirtschaftsinstitut IW warnen vor der AFD, nur um es sich mit den Herrschenden nicht zu verderben, deren Ideen und Vorschläge erst für die deutsche Krise gesorgt haben.
Staatliches Geld ist nur gegen staatliche Lenkung zu haben. Von Wirtschaft versteht der Staat wenig, von Technologie nichts. Und steuern kann er beides nicht.
Ergo hat sich der Staat aus Technologie und Wirtschaft weitestgehend herauszuhalten.
Der Staat hat lediglich einen möglicht weiten Ordnungsrahmen zu garantieren. Darüber hinaus sollte der Staat eine öffentlichen Bildungs- und Grundlagenforschungs-Infrastruktur beeitstellen, deren Ergebnisse alle zugute kommen.
Wenn man sich die Wirtschafts- und Technikgeschichte der letzten 200 Jahre betrachtet, sind nahezu alle technischen und wirtschaftlichen Fortschritte durch die Wirtschaft erzielt worden.
Kurz gesagt, Linke haben grundsätzlich Angst vor Innovationen, mit einer Ausnahme , wenn sie glauben es hilft vermeintlich dem Klima!
..den braun-grün-roten Sozialisten war schon ISDN und Transrapid zu viel, die Verbotsliste des Nichtverstehens ist seitdem ins Unendliche gewachsen.
Deren Niveau ist auf Winkelemente und Reimdich-Schwachsinn einfach stehengeblieben.
Und seit Vance freihändig die Noten verteilt hat, ist Sitzenbleiben und Maulsperre angesagt. Auch so eine Art Fortschritt.
Wer ständig zu spät kommt, ist irgendwie auch pünktlich.
Die Dummheit der europäischen Politiker ist zwar toll zum Geschäftemachen, aber das Glasperlen-sind-toll-Niveau der hiesigen Polit-OK geht selbst den Amis auf die Nerven.
Es gab da schon Ende der 1970er Jahre einen Witz:
Auf einer Messe treffen sich ein Ami, ein Japaner und ein Deutscher an einem Stand und gucken sich ein neues Gerät an. Sagt der Japaner: „Kann man das nicht kleiner machen?“ Daraufhin der Ami: „Damit kann ich reich werden, ich kaufe 100000 Stück.“ Der Deutsche schleicht einige Minuten drum herum und sagt dann: „Wir sollten vorsichtig sein, das könnte gefährlich sein, das muss man erstmal genau prüfen und beobachten.“
Zitat: „Doch dieser Erfolg ist kein Zufall. Er basiert auf jahrzehntelanger staatlicher Unterstützung für die Technologieentwicklung.“
> Mhh, verstehe ich nicht ? Denn wenn ich auch grad so an die letzten Jahre denke, dann wurden bei uns doch die staatlichen Subventionen stark bemängelt und abgelehnt. Und hier wird nun eine „jahrzehntelange staatliche Unterstützung“ für gut befunden und gelobt. Verkehrte Welt?
Wichtigste Voraussetzung ist, dass man mit der Investition auch Geld verdienen kann, ohne dass der übergriffige Staat jeden € für seine Sozialgeschenke einkassiert und trotz der mageren Rendite der Besitzer für den (manchmal vorübergehenden) Wert des Unternehmers der pure Neid entgegenschlägt.
Treibt der Staat den Unternehmer in die Pleite, dann war der vorher erfolgreiche Unternehmer unfähig.
Das ist nicht das Problem. Früher war alles erlaubt, was nicht verboten war. Mittlerweile ist alles verboten, was nicht erlaubt ist. Für jeden Mist braucht es eine Genehmigung. Und die gibt es selten.
Wie viele IT-Unternehmen wurden seit 1980 mittels Schikanen aus D vertrieben? Ich sage nur SUN und Elsa. Dass AVM noch da ist, grenzt an ein Wunder. Man könnte fast glauben, die nutzen dem Staat.
Sehr geehrter Herr Tichy, ich habe von 1967-1971 am „Roten Kloster“
Journalistik studiert. Während des Studiums, ich wollte, da Sportler,
Sportjournalist werden, wurde uns Studenten die Rolle des Journalisten
beigebracht: Propagandist, Agitator und kollektiver Organisator. Diese
Rolle paßte nicht zu mir. So begab ich mich zu meinen Wurzeln, studier-
te Lehramt und wurde Sportlehrer. Heute würde ich gern meine Journa-
listenkenntnisse, transformiert auf „demokratische“ Verhältnisse, anwen-
den, sogar als Volontär. Unter einer Bedingung: In Ihrer Redaktion!
„Mit, nicht gegen die Wirtschaft“
„It’s the economy, stupid“
James Carville 1992
Und heute?
„It’s the migration, stupid“?
Wir werden sehen
Buntland hat fertig. Der Kipppunkt ist bereits überschritten. Das wird nix mehr.