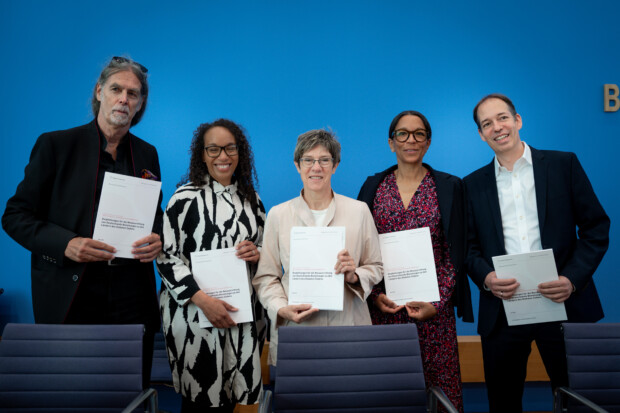Die Kommission „Welt im Umbruch – Deutschland und der Globale Süden“ fordert eine „Neuausrichtung“ der Beziehungen Deutschlands zu den Ländern des Globalen Südens. So heißt es anlässlich der Vorstellung des Abschlussberichts der Kommission. Ein Jahr lang hatten „zehn hochrangige Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft“ im Austausch mit weiteren internationalen „Experten“ aus eben jenen Bereichen Empfehlungen erarbeitet, die sie nun der Regierung vorgelegt haben.
Der Bericht deckt viele und komplexe Themenbereiche ab: Die europäische und globale Sicherheitskonstruktion wird ebenso auf notwendige Anpassungen überprüft wie finanzwirtschaftliche oder humanitäre Aspekte. Insgesamt werden sechs Bereiche beleuchtet: Geopolitik, Entwicklungspolitik, Ökonomie und Handel, Arbeitsmigration, internationale Finanzen und schließlich Klimapolitik.
Das ist korrekt. Zum einen zeigt sich hier eine wohltuend pragmatische Perspektive: Anstatt weinerlich und im Entrüstungsmodus zum Beispiel die Trumpsche Administration zu dämonisieren, wird deren „disruptiver“ Charakter lediglich beschrieben, und als Phänomen betrachtet, mit dem man umgehen muss. Die „sich abzeichnende (…) multipolare“ Weltordnung wird ohne Wertung zur Kenntnis genommen. Diese Sachlichkeit geht zwar vorhersehbarer Weise bei gewissen Themen ein Stück weit verloren, ist aber zumindest ein Schritt in die „richtige“ Richtung.
Angesichts der anstehenden globalen und nationalen Herausforderungen ist erstaunlich, dass die Initiative zu einer intensiven Auseinandersetzung mit diesem Thema nicht vom Auswärtigen Amt oder gar von höchster Stelle ausging, sondern von dem aus nachvollziehbaren Gründen in Verruf geratenen NGO-Milieu: Die Kommission wurde von der Global Perspectives Initiative angestoßen, eine laut Selbstbeschreibung „unabhängige und politisch neutrale Dialogplattform“, die „multilaterale Zusammenarbeit stärken“ möchte, wobei die europäisch-afrikanischen Beziehungen im Mittelpunkt stünden.
So ist jedenfalls nicht verwunderlich, dass das „nationale Wohlergehen“ hier mit mannigfaltigen Interessen – keineswegs neutraler Art – konkurriert: Insbesondere die allgegenwärtige Verquickung aller Anliegen mit dem Klimaschutz als übergeordnetem und nur nach fixen ideologischen Gesichtspunkten bewertetem Ziel legt eine Ausrichtung fest, die zumindest in Frage gestellt werden muss: So gelten fossile Brennstoffe hier als „Globale Gemeinschaftsgüter“, und der Bundesregierung wird geraten, sich für den „Aufbau von CO₂-Bepreisungsmechanismen auf allen Kontinenten“ einzusetzen. Das steht den Bedürfnissen und Interessen armer Länder diametral entgegen. Auch das Ansinnen, diese Länder sollten doch die Bepreisung als Geldquelle für sich entdecken, ist einigermaßen kontraproduktiv, wenn an anderer Stelle die Stärkung der Privatwirtschaft als wünschenswertes Ziel genannt wird.
Auch die Haltung zu Migration ist klar ideologisch besetzt: Insgesamt wird das Narrativ der Notwendigkeit von Arbeitsmigration nicht in Frage gestellt. So etwa kommt der Begriff „Brain Drain“ nicht einmal vor – dabei ist das Abwerben der Talentiertesten und Fähigsten aus armen Ländern im Grunde eine Einbahnstraße, die Kompetenz und Potenzial in den Westen lenkt, der dafür lediglich kurzfristig und zumeist wenig nachhaltig pekuniären Ausgleich bietet.
Stattdessen überwiegt die Darstellung, dass Arbeitsmigration als „Triple-Win“-Situation gestaltet werden könne: Staaten mit junger Bevölkerung, aber zu wenig Arbeitsplätzen profitierten in diesem Sinne ebenso wie die von Fachkräftemangel und alternder Bevölkerung geplagten Länder des Westens; und schließlich sei dies auch für die Individuen von Vorteil, einerseits durch Geld, das in die Heimat geschickt wird, andererseits durch Bildungs- und Karrierechancen, die sich im Heimatland unter Umständen nicht bieten.
In all dem steckt ein wahrer Kern, und der Bericht macht sehr deutlich, dass dies nur für echte Arbeitsmigration gilt: Er fordert, diese von Asyl und Flucht strikt zu trennen. Das ist insbesondere im Hinblick auf die Vermittlung des Themas durch Politik und Medien überfällig, wird aber bewusst hintertrieben, weil es ideologischen und pseudomoralischen Maßgaben widerspräche.
Ebenso überfällig ist die Forderung nach klaren, praktikablen Lösungen für Arbeitsmigration, die es natürlich immer in einem gewissen Maß geben wird und muss: So wird die Implementierung von Fast-Track-Regelungen und die Einrichtung einer Nationalen Einwanderungsagentur angeregt: Tatsächlich besteht eine Schieflage darin, dass massenhafter illegaler Einwanderung wenig entgegengesetzt wird, während reguläre Einwanderung hohen bürokratischen Hürden unterliegt.
Es ist an sich unbegreiflich, wieso ein Land, in dem Politiker seit 50 Jahren steif und fest behaupten, es handle sich um ein Einwanderungsland, solche Regelungen bisher nicht umgesetzt hat. Der Grund dafür liegt freilich auf der Hand: Deutschland ist kein Einwanderungsland, sondern lediglich ein Land, in das viele einwandern. Der Begriff „Einwanderungsland“ bezieht sich aber nicht nur auf den Wunsch der Fremden, einzuwandern, sondern auch auf die entsprechende Mentalität der Einheimischen, und die ist weder in der Bevölkerung noch in der Politik gegeben.
Allerdings ist bemerkenswert, dass angesichts der Einbindung von Sachverständigen aus allen thematisierten Bereichen und aus unterschiedlichsten Organisationen und Institutionen kein kritisches Wort über die Belastung fällt, die Arbeitsmigration darstellt. Immerhin bedeutet sie immer zerrissene Familien, oft Heimatlosigkeit, Einsamkeit, und vielerlei mehr, was die positiven Aspekte für das Individuum stark relativiert. Ein Bericht, der sichtlich ganzheitlich angelegt ist, kann dies eigentlich nicht ignorieren, ohne einen doch deutlichen Mangel an Objektivität zu verraten.
An dieser Stelle lassen die Empfehlungen aufhorchen. Sie mahnen einen echten „Paradigmenwechsel“ an – bei allem expertisegesättigten, aufgebauschten Wortgeklingel wird die Politik dazu eingeladen, den Ernst der Lage zu erkennen, und von Radwegen in Peru Abstand zu nehmen: So wird ein Ansatz gefordert, „der nationale Interessen verfolgt, globale Herausforderungen berücksichtigt und die Interessen der Partner als gleichberechtigt anerkennt“. Demgegenüber wird konstatiert: „Eurozentrismus, verschärft durch moralischen Rigorismus, wäre jetzt genau die falsche Rezeptur.“ Realpolitik statt Idealpolitik, die in dem denkwürdigen Satz mündet: „‚Gemeinsame Werte‘ funktionieren nicht.“
Ein Bericht also, der mit Licht und Schatten aufwartet, und der, trotz erkennbar linksideologischer Schlagseite, kein schlechter Ausgangspunkt wäre, um Entwicklungszusammenarbeit und generell das Verhältnis zwischen Deutschland und Ländern der Zweiten und Dritten Welt gründlich zu überdenken.