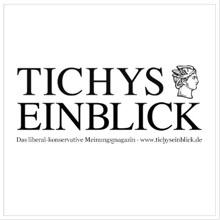Als der Vorsitzende der damals noch Konservativen in der Hansestadt Jürgen Echternach hieß, höhnte der nie um einen Kalauer verlegene Herbert Wehner: „In Hamburg kommt die CDU echt danach.“ Bei der Wahl am Sonntag stimmte das nicht mehr so ganz. Zwar landete die Unionspartei nach der ersten ARD-Prognose mit 19,5 Prozent sehr deutlich hinter den Sozialdemokraten des Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher, der 33,5 Prozent holte – ein deutlicher Verlust zu 2020, als die SPD fast 40 Prozent bekam, aber nach wie vor Platz eins.
Allerdings schob sich die CDU diesmal vor die Grünen, die spektakulär von ehemals 24,2 auf 17,5 Prozent abstürzten. Beim ZDF-Trend von 19 Uhr liegen CDU und Grüne zwar deutlich näher beieinander – aber auch hier führt die CDU mit 20 Prozent mit 0,2 Prozent vor dem Konkurrenten. Darin hatte die eigentlich interessante Frage des Hamburger Wahlkampfs bestanden: Wer kommt auf Platz zwei?
Die traditionell schmalbrüstige CDU der Freien und Hansestadt verdoppelte immerhin fast ihr miserables Resultat von 2020, damals gerade 11,2 Prozent. Sie könnte damit die rot-grüne Rathauskoalition ablösen. Entscheiden muss nun Tschentschers SPD, die über das Privileg der Partnerwahl verfügt – anders als die Union im Bund. Verglichen mit den Verlusten bei der Bundestagswahl von fast 10 Prozentpunkten hält sich Tschentschers Minus von 5,7 Prozent noch in Grenzen.
Das liegt offenbar an der Person des Ersten Bürgermeisters: Nach Daten der ARD erklärten 31 Prozent der Wähler, dass sie die SPD vor allem wegen ihm ankreuzten. Zu seinem relativ wirtschaftsfreundlichen Kurs würde es passen, die CDU als neuen Partner einzuwechseln – zumal die sich ihre Chancen nicht durch eine zu große Eigenwilligkeit bei den Koalitionsverhandlungen verderben dürfte.
Für den herben Verlust der Grünen unter Wissenschaftssenatorin Katarina Fegebank gibt es mehrere Gründe: zum einen natürlich das schlechte grüne Bundestagswahl-Ergebnis, der Verlust der Regierungsbeteiligung im Bund und die Frustration über die desaströse Ampel-Bilanz. Aber auch die Lustreise der Justizsenatorin Anna Gallina auf Malta inklusive Hummeressen auf Fraktionskosten im Jahr 2020 und der beherzte private Griff von Gallinas früherem Lebensgefährten Michael Osterburg in die grüne Fraktionskasse dürften vielen im Gedächtnis geblieben sein – zumal Gallina ihren Posten behalten durfte.
Für die Grünen markiert das Hamburger Ergebnis einen weiteren Schritt auf dem Weg nach unten – zumal, wenn auch noch der Gang in die Opposition bevorstehen sollte. Bitter fällt das Resultat für sie vor allem deshalb aus, weil Hamburgs Wählerschaft mehrheitlich nach links tendiert. Immerhin holte die Linkspartei offenbar gerade wegen ihrer Radikalisierung zu einem autoritär-sozialistischen Verein diesmal 11,5 Prozent, mehr noch als vor fünf Jahren, als sie mit 9,1 Prozent abschnitt.
An der Elbe wiederholt sich nun offenbar der gleiche Vorgang wie schon zur Bundestagswahl: Unter dem Eindruck eines auch von den Grünen befeuerten Endkampfs gegen einen vermeintlich drohenden Faschismus wandern etliche Wähler von den Grünen zur radikaleren Linkspartei, also der Kraft, die die entsprechenden Parolen immer noch lauter und schriller vortragen kann als Habecks Partei.
Die AfD gewann in der Stadt, in der sie noch nie viele Stimmen holen konnten, gut drei Prozentpunkte auf 8,5 Prozent dazu. Dass die FDP klar draußen blieb, erfüllt die allgemeinen Erwartungen und selbst die der Freidemokraten. Bevor sie sich nicht deutlich in die eine oder andere Richtung sortieren, bleibt ihnen wahrscheinlich überall nur ein Platz in der Rubrik ‚Sonstige‘.